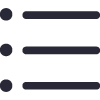One Health: StadtGesundheit und Biodiversität.
Einführung in das Rundgespräch
Michael Schloter
9-10
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch von mir vielen Dank, dass Sie so zahlreich zu dem Rundgespräch erschienen sind. Sie haben sich vermutlich beim Lesen der Einladung gefragt, ob mit dem Wort 'StadtGesundheit' im Titel der Veranstaltung die Gesundheit von Städten, d. h. des Ökosystems Stadt gemeint ist oder die menschliche Gesundheit. Dieses oder können wir heute streichen; was wir mit Ihnen diskutieren wollen, ist vielmehr ein und. Die Gesundheit urbaner Ökosysteme hängt sehr eng mit der menschlichen Gesundheit zusammen. Wenn wir die zugrundeliegenden Zusammenhänge und Interaktionen begreifen, können wir beginnen, die Ökosysteme in Richtung zu mehr Gesundheit zu steuern.
Das ist nichts Neues. Bereits vor 2500 Jahren hat der griechische Arzt und Lehrer Hippokrates (460 bis ca. 370 v. Chr.) gesagt, ein gesunder Mensch lebt in einer gesunden Umwelt. Damit entstand die Idee, dass der Zustand der Umwelt sehr eng mit der Gesundheit des Menschen verknüpft ist (Badash et al. 2017). Das Konzept von Hippokrates wurde in den 1950er und 1960er Jahren wieder aufgegriffen, zunächst bezogen auf die enge Verknüpfung der Gesundheit von Tieren und Menschen. Man hat sich damals primär mit Zoonosen und Antibiotikaresistenzen beschäftigt, dann aber relativ schnell festgestellt, dass dies zu einseitig ist. Beide, Tiere und Menschen, leben in einer Umwelt, deren Zustand ebenfalls in Betracht zu ziehen ist, wenn es darum geht, die Gesundheit von Mensch und Tier vorherzusagen oder auch zu beeinflussen. So ist das One-Health-Konzept entstanden: Wir brauchen gesunde Ökosysteme und gesunde Tiere, erst dann geht es auch uns Menschen gut.
Gesundheitsrisiken im urbanen Raum
Annette Peters
11-21, 2 Farb- und 1 Schwarzweißabbildungen, 1 Tabelle
Die Gesundheit der Bevölkerung im urbanen Raum wird von Umweltfaktoren, aber auch dem sozioökonomischen Kontext beeinflusst. Luftschadstoffe, Lärm und Hitze haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit, während Grünflächen und städtische Infrastrukturen die Gesundheit der Bevölkerung verbessern. Die Luftschadstoffe Feinstaub und Stickstoffdioxid sind für die größte Krankheitslast im urbanen Raum verantwortlich. Daher wird die Novellierung der Grenzwerte für diese Schadstoffe auf europäischer Ebene eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen in den Städten bewirken. In Zeiten des Klimawandels erhält die Rolle der Umwelt eine immer größere Bedeutung. Dabei ist für die Gesundheit die Hitze das wichtigste Thema in Deutschland. Hitze belastet insbesondere das Herz-Kreislauf-System und kann beispielsweise Herzinfarkte auslösen. Große, prospektive Kohortenstudien, wie die NAKO Gesundheitsstudie, können hier einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis der gegenwärtigen und zukünftigen Auswirkungen auf die Gesundheit leisten. Für zukünftige Betrachtungen und zur Anpassung an die sich ändernden Bedingungen ist es entscheidend, das Zusammenspiel der Umweltfaktoren und die Rolle des sozioökonomischen Kontextes besser zu verstehen.
Das urbane Umfeld - ein Hotspot für antibiotikaresistente Mikroorganismen?
Michael Schloter
23-30, 1 Farbabbildung
Mikroorganismen sind nicht nur wichtige Katalysatoren von Ökosystemleistungen und damit indirekt mit unserem Wohlbefinden verbunden, sie interagieren auch direkt mit unserem Körper und steuern so maßgeblich unsere Gesundheit. Das 'humane Mikrobiom' ist daher ein wichtiger Bestandteil medizinischer Forschung geworden, da Mikroorganismen für Funktionen in unserem Körper verantwortlich sind, die wir selbst nicht leisten können. Neben der initialen Übertragung von Mikroorganismen von der Mutter auf das Baby während der Geburt ist die Umwelt, mit der wir ständig in Kontakt sind, die Hauptquelle unseres Mikrobioms. Gerade in Städten ist aber das Mikrobiom durch den anthropogenen Einfluss stark verändert und damit haben sich auch die Muster, welche Mikroorganismen aus der Umwelt akquiriert werden, stark verändert, mit entsprechenden Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Der Beitrag zeigt die verschiedenen Wechselwirkungen zwischen Umweltmikrobiomen und unserem Mikrobiom im städtischen Umfeld mit einem besonderen Fokus auf antibiotikaresistente Mikroorganismen und stellt Handlungsempfehlungen für die Zukunft vor.
Zur Bedeutung des Mikrobioms im Exposomkonzept
Gabriele Berg
31-39, 2 Farb- und 1 Schwarzweißabbildungen
Im Rahmen der Exposomforschung wird die menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit Umweltfaktoren analysiert. Neben der Exposition gegenüber Umweltchemikalien, Lärm und Urbanisierung ist auch das Mikrobiom ein wichtiger Expositionsfaktor, der insbesondere über die Ernährung und den Lebensstil vermittelt wird. Jede Mahlzeit mit Gemüse, Obst und Kräutern enthält potenziell Billionen von Mikroorganismen mit diverser genetischer Kapazität; deshalb wurde das Konzept des 'essbaren Mikrobioms' eingeführt. Die Vernetzung zwischen Mikrobiomen ist wichtig, um die Bedeutung für die Gesundheit zu verstehen. Exemplarisch wird das Mikrobiomnetzwerk vom Boden über die Pflanze (bis in deren essbare Teile) bis zum menschlichen Darm dargestellt. Gleichzeitig wird die Wirkung urbaner Faktoren wie Luftschadstoffe auf das Mikrobiom bewertet. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass die mikrobielle Diversität der Umwelt mit der des Menschen verbunden und essenziell für unsere Gesundheit ist. Die Mikrobiomforschung hat hier einen Paradigmenwechsel vom Krankheits- zum Gesundheitserreger geschafft.
Multifunktionale grün-blaue Infrastruktur für gesunde Städte im Klimawandel
Stephan Pauleit
41-52, 5 Farbabbildungen
Städte und städtische Lebensweisen sind nicht nur eine Hauptursache des Klimawandels, sondern sie werden etwa durch die zunehmende Hitze, Starkregen und Flussüberschwemmungen auch stark bedroht. Grünflächen können helfen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Dazu sollen grüne Netzwerke mit vielfältigen ökologischen und sozialen Nutzen als grüne Infrastruktur entwickelt werden. Für die Stadtentwicklung wird eine Transformation der Freiräume wie Straßen und Plätze erforderlich, um dieses Ziel in den dicht bebauten Innenstädten zu erreichen. Bäume spielen dabei eine zentrale Rolle, denn sie bieten Schatten und kühlen durch Verdunstung. Besonders alte Bäume sind kaum zu ersetzen und verdienen daher besonderen Schutz. Gleichzeitig werden wachsende Städte jedoch immer dichter bebaut und gefährden das Grün und seine Rolle für die Klimawandelanpassung. Das Projekt 'Grüne Stadt der Zukunft' zeigt, dass eine integrative Planung mit umfassender Bürgerbeteiligung erforderlich ist, um eine leistungsfähige grüne Infrastruktur auch in sich verdichtenden Stadtquartieren zu entwickeln und Raumkonflikte mit anderen Belangen wie dem Straßenverkehr zu lösen. Die grüne Infrastruktur ist dazu frühzeitig, umfassend und über alle Planungsphasen und -ebenen hinweg als ein hoch zu priorisierendes Ziel zu berücksichtigen.
Fallbeispiel Zürich: Biodiversität und Hitzeminderung für eine gesunde Stadt
Christine Bräm
53-66, 7 Farbabbildung
Aufgrund der mannigfaltigen Probleme um Klimaveränderung und Biodiversität strebt die Stadt Zürich an, bis 2050 einen Baumschattenanteil von 25 % im Siedlungsgebiet zu erreichen. Aktuell liegt dieser bei etwa 15,5 %. Die Fachplanung Stadtbäume zeigt auf, wie es gelingen kann, das Ziel zu erreichen. Parallel plant die Stadt, den Anteil ökologisch wertvoller Flächen im Siedlungsgebiet auf 15 % zu erhöhen. Von 2010 bis 2020 stieg dieser Anteil von 10,3 auf 10,9 %. Wie es gelingen kann, mit zusätzlichen 225 Hektar das Ziel von 15 % zu erreichen, zeigt die Fachplanung Stadtnatur. Nach einer Volksabstimmung im Jahr 2023 stehen der Stadt Zürich im Programm Stadtgrün Mittel in Höhe von 130 Mio. Franken bis ins Jahr 2035 zur Verfügung, um die Stadt im Bestand stärker zu begrünen. Das Programm stellt Beratung und großzügige finanzielle Mittel für private Grundeigentümerinnen und -eigentümer sowie für öffentliche Räume und städtische Liegenschaften zur Verfügung. Bei der Begrünung der Stadt stellen sich verschiedene Herausforderungen. So verhindert eine starke Zunahme der Unterbauung von Parzellen gute Baumstandorte und ein nachhaltiges Regenwassermanagement, und Stadtbäume haben wegen schwieriger Standortbedingungen oder aufgrund der industriellen Herstellung von Jungbäumen, die u. a. zu einer genetischen Verarmung führt, Resilienzprobleme. Zürich verfügt nun jedoch über die notwendigen Planungswerke und finanziellen Mittel, die Stadt in Richtung eines Ökosystems mit genügend Platz für Pflanzen und Tiere zu entwickeln. Es gilt, diese zügig umzusetzen, die Stadt mit gutem Vorbild voraus, gemeinsam mit den privaten Grundeigentümern und -eigentümerinnen.
Mehr Raum für Tiere und Pflanzen in der Stadt
Sebastian T. Meyer
67-78, 5 Farbabbildungen, 1 Tabelle
Städtische Entwicklung gefährdet Biodiversität durch den Verlust von Lebensraum und dessen Fragmentierung. Gleichzeitig sind Städte Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Dies sind Arten, die in Resten natürlicher Habitate in der Stadt vorkommen, die aus den ländlichen Kulturlandschaften stammen und sich in der Stadt erhalten konnten, die sich an die Bedingungen der Stadt angepasst haben oder die dort ihre normalen Lebensbedingungen finden, die vom Menschen gezielt angesiedelt werden oder die aus der Umgebung der Stadt zeitweise einwandern. Welche Eigenschaften des öffentlichen Raums es Arten ermöglichen, in der Stadt vorzukommen, haben wir in einem Forschungsprojekt, dem 100-Plätze-Projekt, untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass einerseits jede Form von Vegetation in der Stadt weitere Diversität, insbesondere die von Tieren, begünstigt und andererseits verschiedene Artengruppen unterschiedlich stark auf verschiedene Vegetationsstrukturen wie Grasflächen, Sträucher und Bäume reagieren. Öffentliche Räume mit hoher Strukturvielfalt zu schaffen und zu erhalten, ist daher wichtig für urbane Biodiversität. Damit Tiere und Pflanzen in unseren Städten einen Lebensraum finden, bedarf es weiterer Forschung, um die dafür notwendigen Faktoren mechanistisch zu verstehen. Ein solches Verständnis bildet die Grundlage, um Natur besser in städtische Planungsprozesse zu integrieren und zukünftige Städte lebenswert für Menschen sowie tierische und pflanzliche Mitbewohner zu gestalten.
Urbanes Gärtnern für die Biodiversität und unsere Gesundheit
Monika Egerer
79-91, 6 Farbabbildung
Globale Herausforderungen wie der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt und die öffentliche Gesundheit machen die Bedeutung städtischer Grünflächen für die Ökosystemleistungen und das menschliche Wohlbefinden immer wichtiger. Urbane Gärten sind eine Strategie zur Verringerung der Biodiversitätskrise und zur Förderung der menschlichen Gesundheit in heutigen und zukünftigen Städten. Sie können die Artenvielfalt fördern und den Menschen Erholungsmöglichkeiten, Naturerfahrung, Gemeinschaftssinn und Erholung bieten. Während der COVID-19-Pandemie konnten wir besonders gut beobachten, wie urbane Gärten den Menschen in dieser Zeit das Leben retteten. In diesem Beitrag werde ich erörtern, wie urbane Gärten Lebensraum für Pflanzen- und Tierarten bieten können, um dem Verlust der Artenvielfalt entgegenzuwirken und den Menschen in Krisenzeiten und darüber hinaus einen Ort zum Entspannen und Erholen zu bieten, an dem sie sich wieder mit der Natur in der Stadt verbinden können. Weitere Arbeiten unserer Forschungsgruppe zu städtischen Grünflächen, einschließlich Stadtparks, unterstreichen die Rolle von städtischen Grünflächen für die biologische Vielfalt und die menschliche Gesundheit.
Grüne Wände und Dachbegrünung: Natürliche Lösungen für urbane Umgebungen
Azra Korjenic
93-106, 11 Farbabbildungen
In dem Forschungsbereich Ökologische Bautechnologien der TU Wien werden umfassende Arbeiten in den Schwerpunkten 'Ökologische Materialien und Konstruktionen', 'Green and Innovative Constructions and Buildings' und 'Green and Smart Cities' geleistet. Der Beitrag ermöglicht einen Einblick in den Berufsalltag im Bauwesen durch die Vorstellung verschiedener Projekte im ökologischen Bereich. Fassadenbegrünungen an Gebäuden können die Temperaturen an der Fassade im Sommer reduzieren und im Winter mild halten. Auch der U-Wert kann bei nicht gedämmten Fassaden und dichter Fassadenbegrünung um bis zu 30 % reduziert werden - je schlechter die thermische Qualität der Fassade, desto höher der Effekt. Im Innenraum führt der Einsatz von Begrünungssystemen zu einer Reduzierung der Staubkonzentration und der Nachhallzeit bei allen Frequenzen. Die Behaglichkeits-Diagramme (nach Frank 1975) zeigen, dass sich durch die Begrünung und die damit einhergehende Anhebung der Luftfeuchtigkeit sowie die geringfügige Absenkung der Temperatur das Innenklima in den optimalen Bereich verschiebt. Auch der Synergieeffekt von Dachbegrünungen und Photovoltaikanlagen wurde untersucht. Durch die Dachbegrünung können die Lufttemperaturen unter den PV-Modulen und die Moduloberflächentemperaturen reduziert werden, was sich wiederum positiv auf die Leistung der PV-Anlage auswirken kann. Alle Begrünungssysteme erfordern jedoch eine regelmäßige Pflege. Im Allgemeinen ist eine Wartung von Fassaden- und Dachbegrünungen mindestens ein- bis zweimal im Jahr notwendig. leisten. Die Erfolgskontrolle der erreichten Einsparungsleistungen wird vom PSC durchgeführt.
Resümee und Schlussworte
Johannes Kollmann
107-110
 BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS
BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS